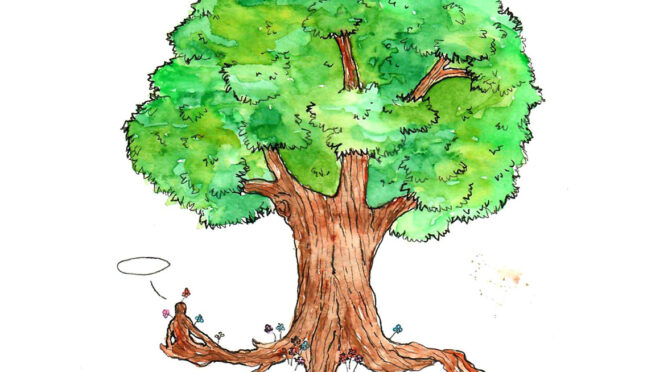Was wäre es, wenn wir uns als Mitglieder einer Allmende des sich immer wieder neu verschenkenden Lebens begreifen? Hemma Rüggen im Interview mit Andreas Weber über das politische Potenzial radikalen Schenkens
von Pioneers of Change Summit 2023, zusammengestellt von
Gudrun Totschnig
Hemma: Ich habe in einem deiner Bücher gelesen, dass du eine Eiche als Mentorin hast. Was bedeutet das? Fragst du sie um Rat?
Andreas: Das tue ich auch, aber das kann man sich natürlich nicht so vorstellen, wie wenn man einen Freund um Rat fragt, der dann sagt: „Also ich würde das jetzt so und so lösen.“ So ist die Eiche nicht, Gott sei Dank, die Eiche ist maximal gewaltfrei, und in ihrem Rat ist nicht enthalten, dass ich etwas anders machen müsste – das macht es natürlich auch schwieriger. Es ist eher so etwas wie die Kommunikation mit dem, was lebt und auch in mir lebt, aber nicht unbedingt darauf angewiesen ist, ein Individuum zu sein. Die besten Ratschläge, die wir geben, die geben wir ja auch, wenn wir interesselos sind an unserer eigenen Individualität, wenn wir sozusagen nur die Lebendigkeit des anderen im Auge haben. Aber ich muss auch sagen: Das Um-Rat-Fragen findet eher selten statt. Also, wenn man sich das so vorstellt: Der Weber, der fährt dann in den Wald mit seinem Fahrrad und fragt die Eiche um Rat, das will das irgendwie nicht so richtig abbilden. Es ist eher so, dass ich mich in ihrer Gegenwart aufhalte und mich vorstelle und dann da bin. Das kann man am ehesten mit dem vergleichen, was in der indischen oder östlichen Spiritualität Satsang heißt, das Sitzen zusammen mit dem Lehrer, das an sich schon gut ist.
Also Verbundenheit zu erleben mit einem Wesen, das nicht menschlich ist? Kannst du beschreiben, was du mit Verbundenheit und Gegenseitigkeit eigentlich meinst?
Andreas: Also wenn mir jemand sagt: „Ich suche Verbundenheit“, dann höre ich da ein Bedürfnis heraus, das aus der Abgetrenntheit herrührt – wie in seine Autonomie geworfen und dort vergessen worden zu sein. Das ist ja ein Zivilisationstrauma, das wir alle haben. Deswegen benutze ich dieses Wort Verbundenheit möglichst nicht, weil ich das gar nicht aktivieren möchte, und weil es für mich sehr wichtig ist, dass es die Erfahrung von Autonomie und meiner Eigenständigkeit gibt. Und diese Form von Autonomie möchte ich aber nicht als Abgetrenntheit denken, sondern als beständigen Austausch, als sozusagen dauernde neue Hervorbringung meiner selbst, was nur in der Gegenseitigkeit mit anderen gelingt. Um das konkreter zu machen: Diese Form von Verbundenheit mit Pflanzenpersonen wie der Eiche haben wir ja schon auf der Ebene unseres Körpers: Ich kann nur atmen, wenn ich Sauerstoff bekomme, den die Eiche ausgeatmet hat, und die Eiche kann nur ihren Körper aufbauen, indem sie CO2 bekommt, das ich ausgeatmet habe. Das ist doch faszinierend, das weiß auch jeder, aber sich das in der Tiefe klar zu machen, dass wir nicht existieren könnten ohne diese Gegenseitigkeit, das tut man nicht so oft. Wenn man verbunden ist, hat man das Gefühl: „Okay, jetzt habe ich die Verbindung und jetzt setze ich mich erstmal hin und chille“, aber so ist das nicht. Es ist eine ständige Aufforderung kreativ zu sein und sich nicht mit dem Alten zu begnügen. Wie unser Körper und auch unsere Seele das ja auch tun, und wie unser Lebenswunsch das ja immer wieder formuliert. Und das Faszinierende ist, dass viele archaische Kulturen das verstanden haben. Die haben verstanden, dass der Mensch mit der Welt in Beziehung steht, weil das die Art und Weise ist, wie sich Individuierung immer wieder neu hervorbringt. Und dadurch sind diese Kulturen auch praktisch unbegrenzt haltbar, unendlich lebensfähig, weil sie nicht die Verbundenheit aufkündigen, die Gegenseitigkeit verhöhnen und alles an sich reißen und dahinraffen.
Wenn du von Gegenseitigkeit und archaischen Kulturen sprichst, kommt bei mir sofort der Gedanke an die Bedeutung von Ubuntu: „Ich bin, weil du bist.“ Aber das muss doch mehr sein als ein Deal: „Ich bin gut zu dir, damit …“ ?
Andreas: Es gibt ja auch im Abendland eine Formulierung, die Gegenseitigkeit als Maxime vorschlägt: „do ut des“ – Lateinisch für „ich gebe, damit du gibst oder damit du gäbest“. Und da ist genau dieser Utilitarismus enthalten. Wobei, wenn wir das „do ut des“ als Maxime unserer Kultur, unseres Umgangs mit allem zugrunde legen würden, dann wäre das schon eine unglaubliche Entlastung, auch wenn „do ut des“ aus dem römischen Rationalismus kommt, der schon ein Vorläufer unserer kapitalistischen Welt, unserer Welt des Objektdenkens war. Bei dieser Form von Gegenseitigkeit bekommen wir nur etwas, wenn wir etwas anzubieten haben. Die ältere Variante des Austauschs, die wunderbar in dieser Ubuntu-Formel „ich bin, weil du bist“ beschrieben ist, geht von dem Haben von Objekten weg. Da geht es nicht mehr um Haben, sondern um Sein, das eigene Sein ist die Gabe und das Sein der anderen ist deren Gabe. Es geht wirklich um ein rückhaltloses Sich-Hingeben an dieses Spiel der Gegenseitigkeit, das beide erschafft. Nicht als Objekttausch gedacht, sondern als Geschenkegeben. Radikales Schenken ist so etwas wie sein eigenes Sein aufs Spiel setzen. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt viele nicht überzeugt. Wir sind groß geworden in diesem „Ich muss genug haben, damit ich mir hier meine Existenz erkaufen darf“. Da ist es sehr schwierig. Uns Vertrauen anzutrainieren, dass es eigentlich anders funktioniert. Der Unterschied ist, dass wir in einer Ubuntu-Welt wissen, dass wir alles haben, was wir brauchen, weil wir alles geschenkt bekommen. Und in der „do ut des“-Welt wissen wir, dass wir immer genügend auf der hohen Kante haben müssen, um uns in schlechten Zeiten unseren Platz zu erkaufen. Das sind rein vom Lebensgefühl her große Unterschiede, und ich glaube, fast jeder hat eine intuitive klare Präferenz, in der Ubuntu-Welt leben zu wollen, weil da sind wir einfach angenommen, aber der Preis ist die eigene Essbarkeit.
Was meinst du mit eigener Essbarkeit?
Andreas: Im Austausch mit der Eiche bin ich ja essbar. In Gegenseitigkeit mit anderen Wesen zu atmen, ist ja meine eigene Essbarmachung. Die Eiche isst mich, indem ich mich selber veratme und verausgabe in die Atmosphäre, und umgekehrt esse ich die Eiche ja auch. Wir sehen, in der Biologie selbst ist die Essbarkeit ja bereits eingebaut – das Geheimnis des Ökosystems ist die komplette durchgängige Essbarkeit ‚aller durch alle‘ und das ist auch seine Blüte und seine Schönheit. Was wir sehen, wenn wir beglückt unter der alten Eiche sitzen oder durch eine Sommerwiese gehen, ist Essbarkeit als Gestalt. Unser zwischenpersönliches Handeln auf Essbarkeit einstellen heißt natürlich nicht, wir müssen uns sofort aufessen lassen, sondern dass wir auf eine Art und Weise handeln, die das Geschenk des Lebens weiterträgt und die nicht daran festhält, dass ich immer genau in dem Zustand bleibe, in dem ich gerade satt und zufrieden bin.
Wie wäre denn eine Wirtschaft, die verstehen würde, dass uns grundsätzlich einmal alles geschenkt ist, auch das ursprüngliche Geschenk des Lebens durch unsere Mutter?
Andreas: Es ist schön, wenn wir das Wort ‚das ursprüngliche Geschenk‘ benützen. Wir könnten sagen: Es gibt ein ursprüngliches Geschenk, das in der konkreten Individuation die Mutter ist, aber auch gleichzeitig die Mutter Erde und auch die ganze sich immer wieder hervorbringende Lebendigkeit, die sich uns aus sich heraus geschenkt hat. Die ganze Erfahrung, dass wir existieren, ist eine Schenkempfängnis-Erfahrung. Und aus dieser heraus haben menschliche Kulturen 98 % der Zeit seit Menschen existieren die Welt verstanden und gestaltet und sich mit den Kulturen der anderen Wesen verbunden. Auch in unserer nicht allzu fernen Vergangenheit, es sind bloß zwei- oder dreitausend Jahre, haben das unsere Vorfahren in Europa gemacht, von denen wir nur noch sehr wenig wissen aufgrund der guten kolonialistischen Arbeit der Römer und der Kirche. Alle ursprünglichen menschlichen Kulturen verstehen den Menschen als Mitglied einer Allmende des sich immer wieder neu verschenkenden Lebens. Es gibt also ein Kulturprogramm, in dem wir die Gegenseitigkeit zum Maßstab machen können, das ist nichts Neues.
Ein weiteres Detail, das sich daraus ergibt, ist, dass diese Welt durch und durch lebt und voller Individuen ist, die alle auch Subjekte sind. Und mit denen gilt es gemeinsam ein gutes Leben zu gestalten und das ist ja ein diametraler Gegensatz zu unserer heutigen Welt, wo alle Objekte sind. Wo die Wissenschaft nach wie vor nichts unterlässt zu beweisen, dass alles Lebendige bloß stumme Objekte sind, wir selber eigentlich auch stumme Objekte sind. Die Erfahrung, dass wir auf einer seelisch bedeutsamen emotionalen Ebene diese Welt mit anderen Wesen teilen, die auch ein solches Erleben haben, die ist noch nicht durchgeschlagen.
Wir sind auf dieser Welt überhaupt nicht die einzigen mit Emotionen und innerer Erfahrung, sondern die Welt als solche ist voller Emotionen und innerer Erfahrung. Und all die Wesen, die diese Emotionen haben, die wollen alle leben – das ist sozusagen der nächste Aufruf zur Gegenseitigkeit. Und es gibt ja heute sehr viel zum Thema Rechte der Natur. Aber das hat mit Rechten eigentlich gar nichts zu tun, sondern es geht erstmal darum, dass wir überhaupt verstehen, dass wir bereits ständig in Beziehung sind mit anderen Wesen. Rechte sind noch immer viel zu westlich, das ist sozusagen immer noch als Besitzstand gedacht. Ich habe das Recht und du hast aber weniger Recht usw., und der Fluss hat nur ein bisschen Recht. Aber so ist das in traditionellen Kulturen überhaupt nicht, sondern das sind ansprechbare Wesen, die wirklich real als Personen mit mir kommunizieren. Diese Perspektive ist gleichzeitig auch eine politische Agenda: Wenn es uns im Verhältnis zur anders als menschlichen Welt darum geht, dass wir in Gegenseitigkeit diese Welt lebendiger machen, dann kann man das schon übersetzen in Landwirtschaftspolitik. Zwar nicht ganz einfach, weil ja alles im Moment auf Objektverbrauch hingedreht ist, aber viele Bauern, die ich kennengelernt habe, möchten ja eigentlich in Gegenseitigkeit mit ihren Wesen handeln und können das aber nicht und müssen dann selber weggucken. Es ist schon mal viel gewonnen damit, wenn es jemandem gelingt, aus der Illusion einer Welt, die nur aus Dingen, die wir arrangieren müssen, sodass wir am besten wegkommen, besteht, auszusteigen. Wenn wir die Welt wieder als Geschenk empfangen können, dann werden wir auch von selbst zu anderen Handlungen kommen. Der Mensch lebt dann aus sich selbst heraus und deswegen richtig.
Ich kenne das tatsächlich, dass wenn ich nicht versuche das Leben auf Distanz zu halten, dass sich das dann eben nach Leben anfühlt. Ob schmerzhaft, schwierig oder was auch immer.
Andreas: Ja, mir ist aber sehr viel daran gelegen, dass ich dieses Lebendige von der eigenen Selbsterfahrung wegdrehe und sage: Es geht darum, dass die Spur, die ich hinterlasse, lebendig macht oder Lebendigkeit stiftet. Also das Gefühl, lebendig zu sein und dafür wild und gefährlich zu leben, wie es mal auf dieser Postkarte hieß, da geht es ja erstmal auch wieder um mich, aber es geht nicht um mich. Ich sage damit jetzt nicht; “Ich bin völlig unwichtig und opfern Sie sich.“ Es geht natürlich auch um die Ausgewogenheit des Tausches der Gaben, aber was am Ende zählt, ist, für das Leben fruchtbar zur werden und nicht selber intensive Lebendigkeit erfahren zu haben. Eine intensive Erfahrung führt sozusagen immer dazu oder dahin, dass das personale Ich außer Kraft gesetzt wird. Der Westen hat die ganzen indischen spirituellen Traditionen, die zum Mainstream wurden, als Selbstverwirklichungsstrategien missverstanden, sonst hätte er das wahrscheinlich auch nicht so konsumiert. Was? Es geht darum, mein Ego aufzulösen? Und was ist dann am Ende noch übrig? Nichts? Nein, das will ich natürlich nicht. Damit könnte man kein Parteiprogramm schreiben. Als Eltern allerdings ist dieses Paradigma, dem Leben zu Dienst sein, sehr spürbar. Das Leben, das wir selbst zeugend austragen und gebären, dem gegenüber haben wir das intuitiv sehr stark. Nicht alle, aber viele Eltern würden sich, wenn sie die bittere Wahl hätten „Soll ich überleben oder mein Kind?“, für das Überleben des Kindes entscheiden. Da sieht man, dass es in uns durchaus eine Verbindung gibt zu dieser Idee, dass ich dem Leben diene, auch wenn der Preis hoch ist.
Der amerikanische Autor und Philosoph Luis Hyde spricht vom Kreislauf der Gabe oder dem Kreis der Gabe – „The Circle of the Gift“. Wenn man ein Geschenk erhält, kann man nicht anders als selbst zu schenken, und wenn man ein Geschenk gibt, wird einem geschenkt – das ist schon ein bisschen ein mystisches Geheimnis. Vielleicht hat es damit zu tun, dass es im Kern dieser Welt das Begehren ganz aus sich heraus zu schenken gibt. Wenn man sich diese Erfahrung zu eigen macht, sozusagen einen Hauch erhält, dann fühlt sich das sowas von richtig und „mir geht es gut“ an, und dann sind wir zu allen möglichen grandiosen Dingen in der Lage. Und da kann natürlich auch viel passieren, wenn Menschen es kollektiv schaffen, sich in so eine Verfassung des Gebenwollens und Gegebenwerdens zu bringen.
Sich als fühlende, verkörperte Intersubjekte in Gegenseitigkeit wahrzunehmen – dann ist das natürlich auch ein Emanzipationsprojekt und ein unabsehbar großes politisches Projekt, da es ja auch die Emanzipation aller anderen fühlenden Subjekte beinhaltet. Also auch der 10.000 Hennen in Legebatterien. Eva von Redeckers sagt in ihrem Buch „Revolution für das Leben“, dass die großen Widerstandsbewegungen derzeit alle etwas mit der Artikulation von Lebenswunsch und Lebensbegehren zu tun haben und dass der Kapitalismus ja so etwas ist wie die Formel, im Namen von Profit und Eigentum Lebendigkeit in toten Stoff zu verwandeln. Und insofern sehen wir, dass eigentlich das einzige große politische Projekt sein kann, für das Leben aufzustehen.
Wir haben ja gut gelernt Mängelwesen zu sein, davon lebt ja unser gesamtes System.
Andreas: Wenn wir wie von Arnold Gehlen postuliert Mängelwesen sind, dann brauchen wir natürlich eine Objektwelt, die uns irgendwie diese Mängel kompensieren hilft. Verstehen wir uns als unerschöpfliches Überflusswesen, dann dreht sich die Perspektive ja sofort um: Von allem, was essenziell ist, habe ich immer mehr als genug, und je mehr ich davon gebe, desto mehr bekomme ich davon auch. Wenn wir Überflusswesen sind, dann sind wir auf die Objekte gar nicht angewiesen, dann können wir uns sozusagen aussuchen, welche wir wirklich brauchen, um den Überfluss noch zu verstärken – das ist eine ganz andere Perspektive. Warum viele Menschen so gerne „in die Natur gehen“, ist, weil sie sich dort als Fülle erleben und ihrer Eigentlichkeit bewusstwerden. Und weil die Natur als Manifest gewordene Lebendigkeit ihnen ja zeigt, wie Lebendigkeit funktioniert. Sie fühlen sich angenommen und beglückt.
Du hast ein paar Mal den Begriff der Allmende verwendet, kannst du den genauer erklären?
Andreas: Allmende – auch das englische Wort Commons wird oft benutzt – kennen vielleicht einige noch von solchen Begriffen wie der Allmendeweide. Auch ein Wald kann eine Allmende sein – da darf dann jeder sein Schwein reintreiben zum Mästen im Herbst. Eine Allmende, die jeder nutzt, der einen Computerzugang hat, ist Wikipedia. Wikipedia ist auch eine Inhalts-/Wissens-/Informations-Allmende. Eine Allmende ist etwas, das von allen erschaffen wird und das alle nutzen dürfen. Allmenden sind Beziehungssysteme, in denen alle, die existieren, beteiligt sind, aus denen alle Geschenke erhalten, damit sie leben können, und an die alle zurückschenken müssen, damit sie weiterleben können. Allmendekulturen sind Kulturen, die Nahrung entnehmen und gleichzeitig durch bestimmte Praktiken, auch rituelle Praktiken, die Fruchtbarkeit der Landschaft steigern – das sind klassische Allmenden. Den Kapitalismus könnte man nun als den Trick definieren, mit dem sich Allmenden in den Besitz Einzelner verwandeln – das ist die Einhegung der Allmende. So wie im 15. und 16. Jahrhundert, als die existierenden Allmenden in Europa von den Adeligen und Großgrundbesitzern einverleibt wurden. Bis dahin hatten die Menschen das Recht, Teile der Landschaft gemeinschaftlich zu nutzen, und dann kam einer daher, der mächtiger war und gesagt hat: „So, das gehört jetzt mir, und ihr könnt mal sehen, was ihr macht.“ Ja, insofern ist die Allmende eigentlich die Urform der menschlichen Wirtschaftsweise. Die meisten Menschen, die bei einer Allmende mitmachen, sich ganz der Lebendigkeit in den Arm werfen, sind irgendwie glücklich – die wissen auch nicht so genau warum, sie beteiligen sich mit ihrem freien Geschenk an etwas, das allen Leben spendet. Da sehen wir wieder, dass wir für die Kooperationen gemacht sind und aus ihr unsere Lebensfreude beziehen können. Das ist die Wirtschaftsform der Zukunft, wobei Wirtschaft ist natürlich zu eng gefasst. Vielmehr ist das die Art und Weise, wie wir das, was wir zum Leben brauchen, so untereinander verteilen und immer wieder neu hervorbringen, dass das Leben gesteigert wird – das ist Allmende.
Wofür, glaubst du, braucht es denn jetzt unseren Mut?
Andreas: Ja, jetzt habe ich mir ja eine Stunde lang oder etwas mehr für diese Frage eine Sprungschanze gebaut.
Also spring weit!
Andreas: Wenn ich so handle, dass mein Handeln immer lebensdienlich oder lebensspendend oder fruchtbar ist, – braucht es dafür auch Mut, weil das ja oft ein Handeln ist, das außerhalb der Norm liegt. Wenn das Leben unser Leuchtturm ist, und zwar nicht unser eigenes Leben, sondern die Arbeit an der Fruchtbarkeit des Lebens, dann ist das, wie es auch ausgeht, immer richtig und immer das Richtige gewesen.